
Dorothee Sölle
Der
Wunsch, ganz zu sein
"...Aber was ist eigentlich
der Inhalt dieses religiösen Bedürfnisses? Wonach sehnen sich
Menschen? Es ist der Wunsch, ganz zu sein, das Bedürfnis nach einem
unzerstückten Leben. Das alte Wort der religiösen Sprache »Heil«
drückt genau dieses Ganz-Sein, Unzerstückt-Sein, Nicht-kaputt-Sein
aus. Dass die kaputten Typen - und wer rechnet sich nicht zuzeiten dazu?
- den Wunsch haben, ganz zu sein, ist nur verständlich. Es ist zugleich
der Wunsch nach einem Leben ohne Berechnung und ohne Angst, ohne äußere
oder bereits verinnerlichte Erfolgskontrolle, ohne Absicherung. Vertrauen
können, hoffen können, glauben können alle diese Erfahrungen
sind mit einem intensiven Glücksgefühl verbunden, und eben um
dieses Glück des Ganz-Seins geht es in der Religion...
Ich halte diesen Wunsch,
dieses religiöse Bedürfnis für unaufgebbar, auch wenn es
schwer ist, darüber zu sprechen. Ernst Bloch nennt das, was ich meine,
»etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand
war: Heimat«. Die Sehnsucht nach Heimat ist die nicht-private Formulierung
desselben Wunsches, ganz zu sein. Blochs Formulierungmacht deutlich, wie
nahe die Religion der Sentimentalität steht. Aber die Angst vor Sentimentalität
ist kein Grund, die Sehnsucht nach Heimat zu verdrängen. Die Angst,
nicht aufgeklärt zu erscheinen, ist kein Grund, sich selber in seinen
Wünschen zu verstümmeln. Die Schwierigkeit liegt nur darin, dass
Bloch wohl nicht recht hat darin, dass da »allen« etwas in
die Kindheit scheine; offenbar gibt es Sozialisationsbedingungen, die diesen
Schein so systematisch abblenden, dass die große Heimatsuche und
Hoffnung, die wir Religion nennen, nicht in Gang kommt. Ich brauche wohl
nicht zu betonen, dass ich das Fehlen dieses Scheins für eine Verstümmelung
der Menschen halte, die sich in den Heranwachsenden und Erwachsenen bitter
rächt: in der Unfähigkeit zu wünschen, in der Armut der
Expression, in der zweckrationalen Verhaftung an eine Alltäglichkeit,
die kein Transzendieren erlaubt.
Wir müssen die Voraussetzungen,
die Menschen zu so etwas wie Glauben bringen können, etwas genauer
klären und zunächst versuchen, die Religion zu verstehen als
einen Akt der Kreativität, in dem Menschen das tun, was sie in aller
Kultur tun: sich die Welt aneignen, die Natur humanisieren, das Schicksal
als den fremden, feindlichen Gott überwinden. Das religiöse Bedürfnis
ist das Bedürfnis, Sinn zu erfahren und Sinn zu stiften. Es gibt keine
Existenz ohne die Suche nach Sinn. Gerade weil ich den Sinn und das Ganz-Sein
nicht finde, sondern mich immer wieder am Sinnlosen, am Absurden, am Nicht-Deutbaren
verletze, darum kann es mir nicht genügen, mich als ein Objekt zu
verstehen, das in deterministische Ketten gelegt ist. Im religiösen
Akt setzen Menschen den Sinn gegen die Sinnlosigkeit, das Ganz-Sein gegen
die Zerstückelung, den Mut zu sein gegen die Angst...
Religiosität ist in
diesem Verständnis zwar auch aus dem Mangel geboren, aber nur aus
dem, der den eigentlichen Reichtum des Menschen ausmacht. Die nicht-religiöse
Haltung schließt ein gewisses Maß an Resignation, an Einsicht
in das Verwirklichbare, das heißt aber auch an Unterwerfung in die
natürlichen Notwendigkeiten ein. Der Mensch ohne alle Religion ist
leichter zufrieden zu stellen. Er ist »vernünftiger«,
weil er ein so großes Ziel - wie das Ganz-Sein, das nicht-zerstückte
Leben - erst gar nicht ersehnt. Die Auffassung des Marxismus, dass die
Religion mit der Abschaffung von materiellem Mangel, von Ausbeutung und
Unterdrückung von selbst verschwinde, setzt nicht nur ein entfremdetes
Verständnis von Religion voraus, sondern ist selbst eine entfremdete
Verkürzung der Wirklichkeit des Menschen, die ihn verleugnet eben
in seiner Fähigkeit zu träumen, sich auszudrücken und sich
zu verwirklichen. Ein konsequent nicht-religiöses Denken rechtfertigt
als vernünftig nur das, was auf Zwecke geht. . . Das religiöse
Bedürfnis ist das Bedürfnis nach erfahrenem Sinn, die Sehnsucht
nach versprochener und sichtbar werdender Wahrheit. Religion ist der Versuch,
nichts in der Welt als fremd, menschenfeindlich, schicksalhaft, sinnlos
anzunehmen, sondern alles, was begegnet, zu verwandeln, es einzubeziehen
in die eigene menschliche Welt. Alles soll so gedeutet werden, dass es
»für uns« wird. Alles Starre soll biegsam, alles Zufällige
notwendig, alles sinnlos Scheinende als wahr und gut geglaubt und gedacht
werden. Religion ist der Versuch, keinen Nihilismuszudulden und eine unendliche
(endlich nicht widerlegbare) Bejahung des Lebens zu leben.
In Variation eines Satzes
von Freud: »Wo Es war, soll Ich werden« lässt sich sagen:
Wo die Fremde, der Zufall und das Nichts waren, soll Heimat, Identität
und Gott sein. Das Wort »Gott« bedeutet dann nicht mehr eine
in einer zweiten Welt beheimatete Übermacht, die von außen in
unsere Welt eingriffe. Es bedeutet nicht mehr einen zweiten Raum, den Himmel,
eine zweite Zeit, nach dem Tode, eine zweite Art von einem unsterblichen
allmächtigen Wesen, das uns als Person gegenübersteht. Wohl aber
benötigen wir das Wort »Gott«, um die noch nicht erreichte
Totalität unserer Welt, die noch nicht erschienene Wahrheit unseres
Lebens auszudrücken. In diesem Sinn lässt sich sagen, dass jeder
Mensch die Frage, ob er an Gott oder an das Nichts, an den Sinn seines
Lebens oder an die absolute Sinnlosigkeit glaubt, immer schon in seinem
Leben entschieden hat...
Die christliche Antwort auf
das unendliche Bedürfnis ist sozial, ist politisch. Der Sinn des Ganzen,
die Aufhebung des Nihilismus, die Motivation für das Leben werden
nicht im Eingehen des Individuums in das Ur-Eine gefunden, der Sinn ist
nicht erfüllt im Eingehen der Seele in Gott, sondern der Sinn wird
in die Interaktion gelegt. »Gott ist Liebe« ist die christliche
Antwort auf die Frage nach dem Sinn, und dieser allgemeine Satz findet
seine Konkretion in den geschichtlichen Erfahrungen der Befreiung. Glaube
als Anteilhaben an dieser Sinndeutung ist ein unendliches Ja, das alle
Formen des Lebendigen einschließt und Einheit unter ihnen stiftet.
Je umfassender das Ja, desto größer die Nähe zu den Menschen;
die Solidarität ist der menschlichste Ausdruck der Gottesliebe.
Natürlich läßt
sich dieser Satz kritisieren. Man kann einwenden: Die Solidarität
ist nicht irgendein Ausdruck von etwas anderem, sondern die Solidarität
ist die Solidarität und nichts anderes. Aber der Hinweis auf die Liebe
zu Gott soll nicht eine Begründung sein, sondern gerade die Abweisung
aller Begründung. Die Solidarität wird, so verstanden, zu einem
absoluten Wert, der unmittelbar auf unser unstillbares Verlangen nach Sinn
und Wahrheit antwortet. Jesus ist als der Mensch für andere Sohn Gottes
in genau dem Sinn, in dem wir auch Söhne und Töchter Gottes sind.
Wir können unsere Sache nicht zweckrational relativieren. Der Kampf
gegen das als schicksalhaft ausgegebene Unglück, das eine bestimmte
Gruppe, Rasse oder Klasse trifft, ist die Fortsetzung des Kampfes Jesu;
Wundertun gegen die Beschädigungen, die wir vorfinden und die als
fatal hingenommen werden, ist noch das mindeste. Wir werden Menschen sein,
so ist uns versprochen - aber nur miteinander. Die Solidarität ist
die christliche Antwort auf den Wunsch der Menschen, nicht zerstört,
nicht maschinisiert, nicht in bloßen determinierten Wiederholungszwängen
zu leben. Die Solidarität wäre zu klein verstanden, wo man versuchte,
sie wissenschaftlich - etwa aus dem Gang der Geschichte - abzuleiten und
sie somit denen zu versagen, die nicht auf der Siegerseite stehen. Der
Ausdruck »Gottesliebe« weist auf den Wunsch des Menschen nach
Sinn, auf sein Bedürfnis nach Totalität.
Das für unsere Kultur
relevante Symbol der Einheit von Gottesliebe und Solidarität ist Christus.
Leben wie Christus gelebt hat, »gesinnt sein wie er war« (Phil2,
5) bedeutet die konsequente Weigerung, die Gottheit »Fatum«,
die uns einredet, »so ist es eben, so war es immer«, an irgendwelchen
Stellen des Lebens weiter anzubeten. Es bedeutet die Hinreise zur Entäußerung
und Hingabe des Ich und die Rückreise mitten in diese Welt. Es bedeutet
sterben lernen und auferstehen. Statt auferstehen können wir auch
sagen: die Rückreise aus einer Art Tod in das Leben antreten.
Dorothee Sölle,
Der Wunsch, ganz zu sein, in: Die Hinreise, Stuttgart 1975, 167-185 (in
Auszügen)
|
|
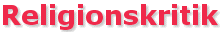
Religionskritik