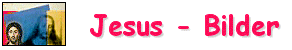
|
Hatte Jesus einen Nachnamen?
Eine Frage macht deutlich:
Die kritische Bibelwissenschaft ist bei vielen Christen immer noch weithin
unbekannt
Doch bei diesem Versuch entstehen unterschiedliche, bisweilen höchst widersprüchliche Jesus-Bilder. Oft liegt es daran, dass man sich einfach auf »den« Wortlaut der Evangelien stützt, die historisch-kritische Bibelforschung entweder nicht kennt oder sie meidet. Dies ist aber eine wissenschaftliche Methode, deren Ergebnisse es nicht mehr zulassen, bestimmte traditionelle Lehren über Jesus unkritisch zu übernehmen. Sie setzt einen Rahmen für das, was wir von Jesus noch begründet sagen können und was nicht. Wie man diesen Rahmen erkennen kann, das ist unter Christen immer noch weithin unbekannt. Deswegen soll es in diesem Dossier an den vier Evangelien demonstriert werden. Ein Schnellkurs in historisch-kritischer Bibelforschung gewissermaßen. Natürlich kann man auch auf anderen Wegen Zugang zur Bibel finden. Niemand muss sich unbedingt erst durch das historisch-kritische Bibelwissen durcharbeiten. Dennoch: Dieses mittlerweile seit über hundert Jahren bestens gesicherte Wissen kann helfen, Glauben und Verstehen gut zusammenzubringen. Man liest die Evangelien, die Bibel überhaupt, anders, wenn man erkannt hat, wie die Texte entstanden sind. Kundige Leser legen langsam ab, was ihnen in der religiösen Erziehung möglicherweise dogmatisch übergestülpt wurde. Er wird deutlich, dass die Ergebnisse der historischen Bibel-Kritik manche traditionelle Lehre der Theologie relativieren. Zum Beispiel die Christologie, die Lehre vom Christus: Diesen Titel, so belegen Bibel-Forscher, hat Jesus erst lange nach seinem Tod erhalten. Im Hebräischen bedeutet er »Messias« und heißt wörtlich »der Gesalbte« Gottes. Die Griechisch schreibenden Evangelisten waren überzeugt, Jesus sei der Messias gewesen. Und so haben sie den Titel wörtlich als »Christos« übersetzt. Heute wird das aber oft gar nicht mehr verstanden. Man denkt dann: Jesus ist der Vorname und Christus der Nachname des Mannes aus Nazaret. Andererseits ist »Christus« für viele Zeitgenossen nur ein anderes Wort für »Sohn Gottes«. Sie wissen nicht, dass dies ein weiterer so genannter Hoheitstitel ist, mit dem die Evangelisten die Besonderheit Jesu ins Bild setzten. Das ist auch der Grund dafür, warum Jesus nie mit seinem Familiennamen genannt wird: Joschua ben Josef, Sohn des Josef. Dabei wäre der leibliche Vater dem himmlischen in die Quere gekommen. Das durfte nicht sein; deswegen führt Josef in den Evangelien eine »un-natürlich« anmutende Randexistenz. Nur so konnte die »Gottessohnschaft Jesu« plausibel gehalten werden. Heute ist klar: Jesus hat keinen dieser Titel für sich selbst benutzt oder akzeptiert. Er hat sich vor allem nicht für Gottes »eingeborenen Sohn« gehalten noch in irgendeiner anderen Weise für göttlich. Wie Jesus sich selbst verstanden hat, darüber können wir nur spekulieren. Das Wort vom »Menschensohn« hat sich schon auf dem Boden des Neuen Testaments überlebt – wenn Jesus es denn überhaupt auf sich bezogen hat. Jedenfalls greift es kein Au-or auf. Bei Jesus stand denn auch einzig Gott selbst im Mittelpunkt des Lebens. Der Jude aus Nazaret muss in einem selten intensiven Kontakt mit Gott gelebt haben. Er traute Gott zu, gesetzesfern lebende Huren oder Steuereintreiber »mehr« zu lieben als Gesetzes-fromme. »Er überwand das Gehorsamsverhältnis zu Gott in ein Liebesverhältnis hinein« (H. Pawlowski). Darin hat er das zeitgenössische Jüdischsein letztlich überschritten, obgleich dieses auch zentral von Gott als dem barmherzigen und liebenden Gegenüber des Menschen sprach (und spricht). Jesus aber betonte, Gottes Liebe sei an absolut keine Voraussetzung gebunden, weder an einen »Bundesschluss« noch an irgendein hersagbares Bekenntnis. Das ist zwar nur ein Strang unter mehreren in der Überlieferung. Aber genau dieser Strang erweist sich in der historisch-kritischen Analyse der Evangelien als authentisch. Er leuchtet zum Beispiel auf im Gleichnis von »Zöllner und Pharisäer« (Matthäus 18, 10). Die Bedingungslosigkeit des Angenommenseins bei Gott macht wohl auch heute noch den Reiz aus, diesem Jesus nachzuspüren. Das Problem dabei: Die kritische Textforschung kann nachweisen, dass keiner der vier Evangelisten Jesus noch persönlich gekannt hatte. Sie stützten sich auf mündliche Überlieferung, auf wenige schriftliche Quellen und auf viel eigenes theologisches Nachdenken. Vor allem im Blick auf die Nöte und Fragen ihrer Gemeinden. Und Paulus? Er hat seine sieben, heute als authentisch anerkannten Briefe noch vor den Evangelisten geschrieben, zwischen den Jahren 50 bis 64. Aber auch er hat über den geschichtlichen Jesus nur aus einem Gespräch mit Petrus erfahren. Das war, wie er schreibt, drei Jahre nach seinem »Damaskus-Erlebnis«. Und es hat ihn offenbar nicht sonderlich beeindruckt (2. Brief an die Korinther, Kapitel 5, 16). Jesus »nach dem Fleisch«, das heißt als Mensch, interessierte ihn nicht. »Damaskus« war ihm ungleich wichtiger, seine visionäre Begegnung mit dem »auferstandenen Christus«. Unter den übrigen Autoren des Neuen Testaments ist ebenfalls niemand, der persönliche Erinnerungen an Jesus hatte. Es ist somit kein Wunder, dass viele Texte im Neuen Testament die Person Jesu mit Vorstellungen belegen, die dieser nicht geteilt hätte. Diese Vorstellungen, Deutungen des Lebens und der Gestalt Jesu, müssen deshalb nicht »unwahr« sein. Aber Jesus selbst hätte ihre mögliche Wahrheit zumindest in seinem Denkhorizont nicht verstanden. Zu diesen Vorstellungen zählt das paulinische Konstrukt des »für uns gestorben«, später zum »Sühnetod Jesu« hochdogmatisiert, nach dem Gott es für nötig hielt, dass Jesus für die Sünden der Menschen am Kreuz sterben musste. Zu ihnen zählt die Einsetzung des Abendmahls, die so, wie sie im Neuen Testament dargestellt wird, nicht auf Jesus zurückgehen kann. Zu ihnen zählt aber auch das Bild des am Ende der Zeit wiederkommenden Christus, der die Menschen für ihre Taten richten wird. Historisch-kritische Bibelforschung liefert nachvollziehbare Begründungen dafür, dass diese Vorstellungen den geschichtlichen Jesus befremdet hätten. Jesus verkündigte Gott. Seine Verehrer im Neuen Testament verkündigten Christus. Seit den Anfängen der historischen Bibelforschung vor zweihundert Jahren steht nun die Frage im Raum: Wie ist aus dem Verkündiger Jesus der verkündigte Christus geworden? Gibt es eine Brücke von Jesus zu Christus? Brauchen wir heute überhaupt solch eine Brücke? Wenn ja, müssen wir nicht eine ganz neue Brücke bauen, die Bedeutung Jesu in ganz andere Bilder fassen als die Evangelisten? Jesus faszinierte Menschen. Von ihm sprachen die Leute auch noch nach seinem Tod und nach den Erzählungen über seine Auferstehung. Aber diese Überlieferung wurde immer mehr ausgeschmückt, Jesus wurde dabei von Mal zu Mal mehr verklärt. Das ist geradezu ein inneres Gesetz allen Weiter- und Neuerzählens. Literaturwissenschaftler haben es längst erkannt und untersucht. Aber die Überlieferung wurde nicht nur ausgeschmückt. Sie wurde auch ins griechische Denken hinein übertragen, in einen Kulturraum, der dem Juden Jesus lebenslang fremd geblieben war. Was wir heute in den Evangelien an Jesus-Überlieferung haben, ist somit nicht die persönliche Geschichte des Nazareners, sondern die Wirkungsgeschichte seiner Person. Die Evangelisten sind Jesus-Erzähler, die selbst nur Überlieferungen von Jesus kannten und verarbeiteten. Darin liegt der Reiz, in ihren Geschichten dem geschichtlichen Jesus auf die Spur zu kommen. Wie aktuell dieses Unterfangen
ist, hat der Religionspädagoge Hubertus Halbfas in einem Vortrag unterstrichen:
»Es geht letztlich darum, erneut bei dem Juden Jesus von Nazaret
anzuknüpfen, von dem wir nach zweihundert Jahren historisch-kritischer
Forschung mehr wissen, als Paulus von ihm wusste. Nötig ist die Rückkehr
vor die Übersetzung des Christentums in hellenistische (griechische)
Denkkategorien. Das kann die Ausgangsbasis einer neuen Freiheit christlicher
Selbstauslegung werden. Um dies anzugehen, hätten die Kirchen zunächst
das nachzuholen, was sie seit hundert und mehr Jahren – um den Preis ihrer
eigenen Wahrhaftigkeit – verdrängen: Die Resultate der historisch-kritischen
Exegese und deren Konsequenzen für die Systematische Theologie in
die Breite der Gemeinden zu vermitteln....
|
|